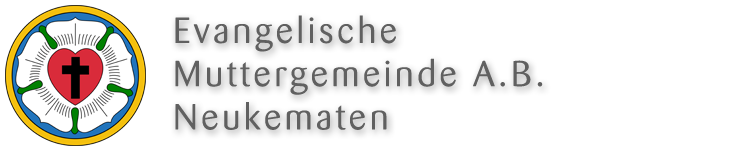Samstag, 26. November 2022: Brückenbauer
Über 500.000 Tonnen Stahl und mehr als 2,5 Millionen Tonnen Beton wurden für die längste Brücke der Welt verbaut. Mit 164,8 km Länge hält der Danyang-Kunshan-Viadukt, eine Eisenbahnbrücke, diesen Rekord und verbindet Shanghai mit Nanking. Was Menschen für einen Aufwand betreiben, um zwei Ufer oder Städte miteinander zu verbinden, ist wirklich enorm.
Neben Brücken aus Beton und Stahl begegnen uns in unserem Alltag auch solche aus Holz, Seilen oder Steinen. Selbst Papier kann als Konstruktionsmaterial dienen, und so können auch Papierbrücken mehrere 100 Kilogramm tragen. Doch die bedeutendste Brücke ist nicht aus Stahl und Beton, Seilen oder Papier gebaut worden, sondern sie ist aus Holz.
Das Holzkreuz, an dem Jesus Christus starb, ist unser Weg, unsere Brücke zu Gott. Jesus ist der perfekte Brückenbauer, der mit seinem Tod am Kreuz die Kluft zwischen Gott und Menschen überwunden hat. Wir Menschen sind nämlich durch unsere schlechten Taten wie Lügen, Neid oder böse Nachrede von Gott getrennt. Gott ist so heilig, dass er in seiner Gegenwart keine Sünde ertragen kann. Jesus aber hat mit seinem Tod am Kreuz alle diese Sünden auf sich genommen und uns damit den Zugang zu Gott ermöglicht. Er ist der Brückenbauer zum ewigen Leben geworden.
Wer daran glaubt und seine Schuld bekennt, der gelangt über diese Brücke zu Gott. Die Bibel sagt: »Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben« (Johannes 3,16). Wie schlimm wäre es, diese wunderbare Brücke nicht zu nutzen!
Ann-Christin Bernack

- Was hält Sie davon ab, über die Brücke, die Jesus »gebaut« hat, zu Gott zu gehen?

- Jesus Christus ist auch für Ihre Sünden am Kreuz gestorben.

- Johannes 3,14-21