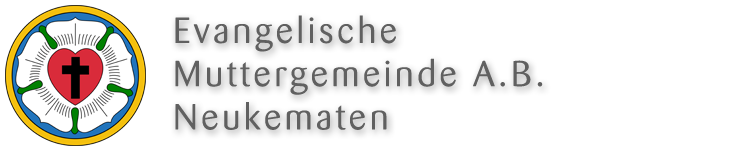Mittwoch, 23. Oktober 2024: Der Schöpfer kennt jedes seiner Geschöpfe, Psalm 139,16

Gott hatte von Anfang unseres Erdenlaufs an alles fest in der Hand. Bereits bei der Mischung der Erbanlagen von Vater und Mutter, beim sogenannten »Crossing over« hat er alles nach seinem Willen gelenkt. Als es dann zur Vereinigung von Samen- und Eizelle kam, hat er wieder genau für die Mischung gesorgt, die er dem werdenden Menschen zugedacht hatte. So begannen wir als ein Wesen, so klein, wie ein i-Punkt in diesem Buch; aber mit allen nötigen Voraussetzungen ausgestattet, die sich nur noch zu entfalten brauchten. Neun Monate lang wuchsen wir dann als völlig hilf- und kraftlose Wesen an dem normalerweise sichersten Ort, dem Mutterleib, heran, wo wir nicht nur weitgehend vor allen Einflüssen der Außenwelt, sondern auch noch von liebender und hoffnungsvoller Fürsorge beschützt wurden.
Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, das sei ein viel zu idealistisches Bild angesichts der tausendfachen Schwierigkeiten, mit denen Eltern und Babys oft zu kämpfen haben. Doch was würde es bedeuten, wenn wir zu dem Schluss kommen müssten, Gott habe entweder kein Interesse mehr an uns oder sei von Anfang an nicht Herr der Lage gewesen? Ich glaube beides nicht, und auch nicht, dass Gott die augenblickliche Bevölkerungsexplosion über den Kopf gewachsen ist. Vielmehr weiß ich, dass Gott die Folgen eigener und fremder Sünden und aller Auflehnung gegen seine heilsamen Gebote zulässt, um uns zur Umkehr zu bringen.
Schon seit dem Sündenfall der ersten Menschen ist diese Erde nicht unsere eigentliche Heimat, sondern ein Ort der Prüfung, der Selbsterkenntnis und der Umkehr zu Gott. Unsere tatsächliche Heimat ist der Himmel; sie ist dort, wo Gott wohnt und denen ein ewiges Zuhause bereitet hat, die zu ihm umkehren.
Hermann Grabe